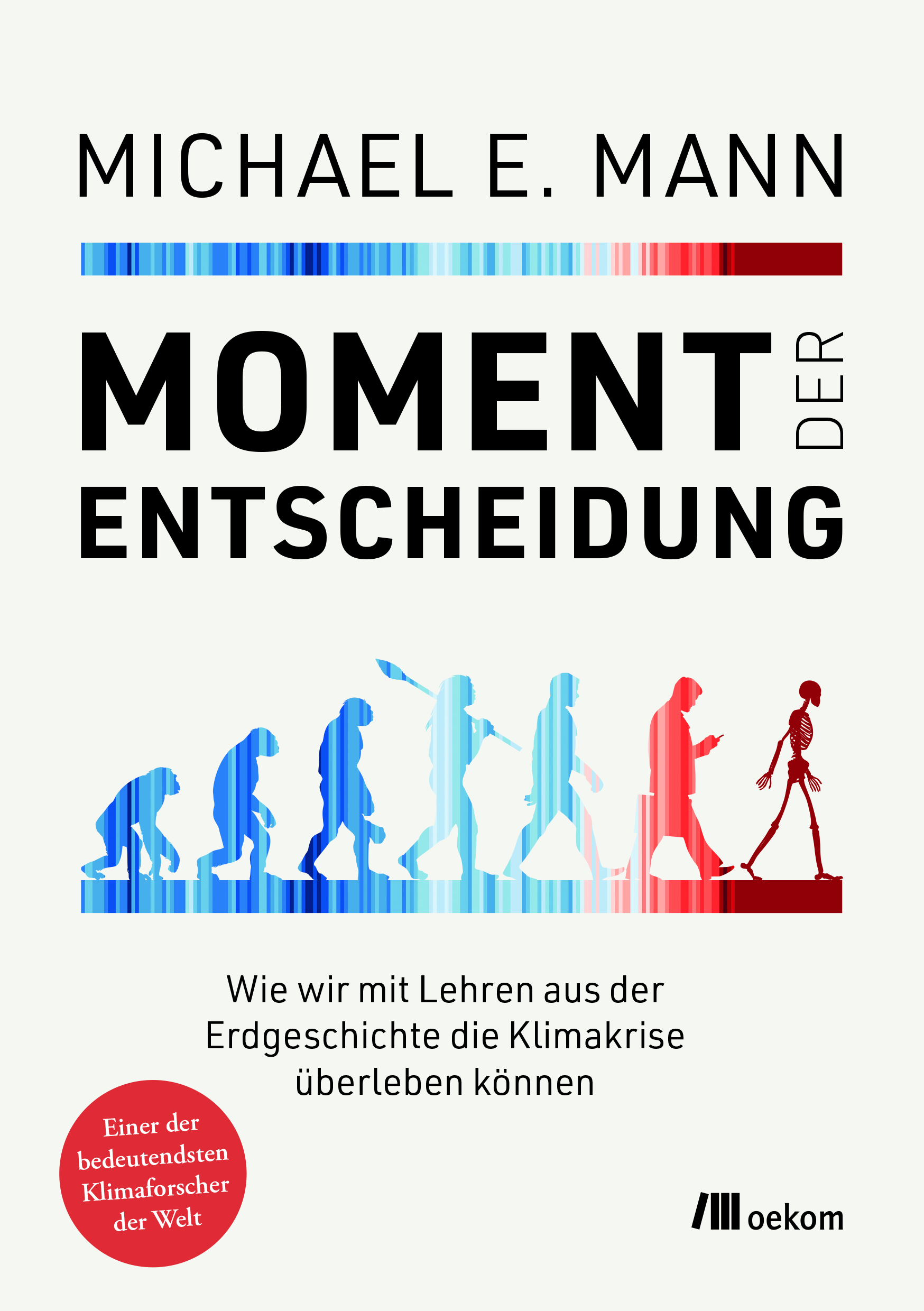Wachstumszwickmühle
Teil 1. Wirtschaftswachstum ohne Grenzen? Unsere Lebensqualität ist nur finanzierbar, wenn die Wirtschaft wächst. Die Wirtschaft braucht dazu immer mehr Rohstoffe. Und diese sind begrenzt, da wir nur eine Erde haben. Der Schnellleser kann jetzt weiterblättern und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Denn die ersten drei Sätze dieses Texts spiegeln unsere Situation vollständig wider. Wer an Hintergründen und Lösungen interessiert ist, kann sich in dieser und den nächsten Ausgaben der Sonnenenergie genauer informieren.
Die Krisenherde
Die letzten Monate waren furchtbar für die meisten Unternehmen überall auf der Welt. Das Ökosystem der Erde aber konnte sich ein klein wenig regenerieren. Die Wirtschaft schrumpfte und die Natur erholte sich. Das ist die gute Nachricht der Weltrezession. Es ist eine Nachricht, über die man einen Moment lang nachdenken muss. Schon vor der Pleite der Lehman-Bank war auf der Welt häufig von einer Krise die Rede, allerdings nicht von einer Krise der Wirtschaft oder der Finanzwelt, sondern von einer Krise des Grönlandeises. Es war eine Zeit, in der Eisbär Knut – stellvertretend für alle Tiere – auf den Klimawandel aufmerksam machte. Es war die Rede von wachsenden Wüsten, gerodeten Regenwäldern und versalzenen Böden. Man konnte damals im Fernsehen sehen, wie ein Hurrikan die amerikanische Stadt New Orleans zerstörte und 1.800 Menschen tötete, wie bei Überschwemmungen in Indien und Bangladesch 3.000 Menschen starben. Man konnte lesen, welche Probleme der Mais im Tank der US-Bürger den Mexikanern in Form von wuchernden Tortillapreisen bereitet. Man konnte auf Klimagipfeln besorgt dreinschauende Regierungschefs sehen, die sagten, es sei höchste Zeit zum Handeln. Sie sprachen von Solaranlagen und Windkraftwerken und fügten an, man dürfe nicht Ökonomie und Ökologie gegeneinander ausspielen.
Klimaschützer Rezession
Die Ökonomie wurde nicht ausgespielt. Im Gegenteil: Sie wuchs weiter. Allein seit dem Jahr 2000 stiegen die weltweiten CO2-Emissionen um zwanzig Prozent, stärker als in den achtziger und neunziger Jahren. Was alle Sonnenkraftwerke der Welt bisher nicht geschafft haben, erledigte nun die Rezession: Die CO2-Emissionen sinken. Offenbar gibt es keinen besseren Klimaschutz als ausbleibendes Wirtschaftswachstum. Weshalb sich die Frage stellt, ob man auch ohne Wachstum auskommen könnte. Eine seltsame Frage in einer Zeit, in der die ganze Welt auf steigende Umsätze hofft.
CO2 auf Wachstumskurs
Das Problem ist erkannt. Alle fünf Minuten misst das Umweltbundesamt auf der Zugspitze den CO2-Anteil der Luft. Er steigt immer weiter, in den Alpen, in der algerischen Sahara, auf dem Mount Wiguan in China oder an den weltweit zwanzig weiteren Messpunkten des Global Atmosphere Watch Program der Vereinten Nationen.
Grafisch dargestellt, zeigt die Entwicklung der weltweiten CO2-Emissionen während der vergangenen sechzig Jahre eine Linie, die von links unten nach rechts oben führt. Die Linie sieht aus wie die Umsatzkurve eines erfolgreichen Autoherstellers. Sie hat auch viel damit zu tun. In den vergangenen sechzig Jahren ist die Weltwirtschaft stärker gewachsen als vom Beginn der Zeitrechnung an bis zum Zweiten Weltkrieg.
Die Umsatzkurve eines Automobilunternehmens steigt jedoch nie kontinuierlich. Es gibt Jahre, in denen die Leute weniger Autos kaufen. Auch die weltweite CO2-Kurve knickt hin und wieder ein. Mitte der Siebziger war das so, oder auch Anfang der Achtziger und der Neunziger. Es waren die Jahre, in denen es der Weltwirtschaft schlecht ging und weniger Autos gebaut wurden.
Der Mensch als Lösungsansatz
Vielleicht könnte die Wirtschaft als Ganzes aber auch ähnlich funktionieren wie der Mensch.
Ein Mensch benötigt zum Leben etwa 2.500 Kilokalorien, ein paar Liter Wasser und etwas Sauerstoff. Er benötigt das jeden Tag, in jedem Jahr. Er braucht nicht morgen mehr als heute und übermorgen noch mehr. Warum muss das anders sein, wenn es um Unternehmen und Konzerne geht? Warum müssen wir immer mehr Autos verkaufen? Warum brauchen wir immer mehr Besitz, mehr Gewinn? Warum brauchen wir unbedingt Wirtschaftswachstum?
Diese Frage ist fast so alt wie die Erklärung der Schwerkraft durch Isaac Newton. Entsprechend oft wurde sie beantwortet. Man muss nur in die wirtschaftswissenschaftliche Abteilung einer größeren Bibliothek gehen. Da steht die Antwort in ökonomischen Lehrbüchern, manchmal versteckt in geometrischen Figuren und mathematischen Formeln, manchmal in etwas umständlichen Sätzen wie diesem: „Der individuelle Nutzen der Wirtschaftssubjekte steigt, wenn mehr Güter und Dienstleistungen gekauft werden.“
Die Wirtschaftssubjekte, das sind die Menschen. Übersetzt heißt das also: Der Mensch braucht Wachstum, weil es ihn glücklich macht. Er mag jeden Tag dieselbe Menge an Kalorien benötigen, aber er will nicht jeden Tag zu Fuß gehen. Er will ein Auto haben. Weil sich aber die Menschen in China, Vietnam oder Bangladesch nur dann irgendwann werden Autos kaufen können, wenn sie immer mehr T-Shirts, Spielzeugautos oder Computermonitore produzieren und verkaufen, brauchen sie Wachstum.
Dieser Antwort lässt sich wenig entgegensetzen. Trotzdem geht sie an der Frage vorbei. Die Hauptverursacher des Klimawandels sind ja nicht chinesische Fließbandarbeiter oder vietnamesische Näherinnen. Es sind Länder wie Deutschland, Amerika, Großbritannien, Frankreich. Länder, in denen es keineswegs an Autos mangelt. Genauso wenig wie an anderen Errungenschaften der Moderne.
Bescheidenheit ist Trumpf
Werden wir wieder lernen, unsere Fahrräder selber zu flicken und unsere Knöpfe anzunähen? Die Zeit des Wachstums ist vorbei, meint zumindest der Volkswirt Niko Paech* in einem Interview mit der Zeit. Hier weist er auf die ökonomische Grenze des Wachstums hin. Die werden wir seiner Meinung früher erreichen als die ökologische, nämlich nach ca. 15 Jahren.
Denn unser auf Wachstum angelegtes Industriemodell als Ganzes braucht Rohstoffe. In den vergangenen Jahrzehnten waren alle Energieträger und anderen Materialien extrem billig und scheinbar unendlich verfügbar. Das ist vorbei. Der Ressourcenhunger von Aufsteigernationen wie Indien, China, Brasilien oder Südafrika treibt die Preise der Rohstoffe nach oben. Das ist unumkehrbar. Sollte sich die Weltwirtschaft erholen und die Wachstumsrate der Ressourcennachfrage weiterhin höher sein als die Wachstumsrate der Fördermengen, kollabiert das auf Fremdversorgung basierende Wohlstandsmodell (siehe auch Artikel „Auf der Straße in die Mangelwirtschaft“ in diesem Heft).
Die Internationale Energieagentur hat erstmals prognostiziert, dass der Preis für ein Barrel Rohöl bald bei über 200 Dollar liegen wird. Auch der Autohersteller GM kalkuliert nun mit einem Preis von 150 Dollar pro Barrel. Das ist ein Paukenschlag, den wegen der Finanzkrise und Wirtschaftkrise nur niemand richtig wahr genommen hat. Ein so hoher Ölpreis bedeutet, dass nicht nur Benzin und Kerosin, sondern auch alle Produkte so teuer werden, dass es der Wirtschaft schwerfallen wird, noch zu wachsen. Auch Bundespräsident Horst Köhler ermahnte diese in seiner Reden zur Nation, wir müssten das Wachstums-Postulat überdenken.
Die Post-Wachstums-Ökonomie
Nach Paech werden wir bald anfangen, unser Leben zu entrümpeln und zu entschleunigen. Wir werden auf Fernreisen verzichten und wieder mehr Produkte aus der Region kaufen, weil die nicht so hohe Transportkosten verursachen. Wir werden Produkte länger nutzen, sie reparieren und pflegen und sie lieber gebraucht kaufen als neu. Wir werden Knöpfe selber annähen und Fahrräder eigenhändig reparieren. Vielleicht wird das sogar Spaß machen.
Wachtumsziel und Treibhausgasausto
Viele Entscheidungsträger/innen aus Wirtschaft und Politik können offenbar Klimaschutzmaßnahmen nur dann akzeptieren, wenn sie sich wirtschaftlich rechnen. Green Growth verheißt die Botschaft, „dass ‚Umweltverträglichkeit‘ und ‚Wachstum‘ Hand in Hand gehen können“ (OECD Ministerrat 25. Juni 2009). Anlässlich des Klimagipfels in Kopenhagen rechnen etliche Studien internationaler Organisationen vor, dass der weltweite Treibhausgasausstoß bis 2050 halbiert werden soll, während die Weltwirtschaft um jährlich rund drei Prozent wächst, also sich insgesamt etwa verdreifacht. Für hochentwickelte Industrieländer bedeutet dies sogar eine achtzigprozentige Treibhausgasreduktion bei allerdings „nur“ zwei Prozent Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Anders ausgedrückt: Trotz Kopenhagen soll das implizite Wachstumsziel der Lissabon-Strategie der EU weiterhin gelten. Wie soll das funktionieren?
Energierevolution notwendig?!
Die Internationale Energieagentur (IEA) hält eine „Energierevolution“ für notwendig. Dahinter verbirgt sich aber technologischer wie ökonomischer Optimismus. Abgesehen von den bekannten Problemen der von der IEA beworbenen Nuklearenergie befinden sich auch die unterirdischen Kohlenstoffspeichertechnologien (etwa in alten Gasfeldern) erst im Erprobungsstadium.
Erneuerbare Energieträger sind in Form von Sonne, Wasser oder Wind in ausreichendem Maße vorhanden, die Technologien zu deren Nutzung jedoch mitunter noch nicht ausgereift. Der weitaus größte Anteil am Emissionsrückgang soll allerdings durch bessere Energieverwertung erreicht werden. Und genau da liegt das Hauptproblem: Die gesamtwirtschaftliche Energieeffizienz der Industrieländer stieg in den vergangenen Jahrzehnten jährlich um knapp über ein Prozent, was durch stärkeres Wirtschaftswachstum bei weitem überkompensiert wurde: Der Energieverbrauch stieg immer weiter an.
Wirtschaftswachstum frisst Effizienz
Wollen wir unser Kopenhagenziel bis 2050 allein durch Effizienzsteigerung erreichen, müsste die Energieproduktivität bei gleichbleibender Wirtschaftsleistung jährlich um 3,5 Prozent steigen. Soll die Wirtschaft dabei auch noch um zwei Prozent pro Jahr wachsen, wären sogar jährlich 5,4 Prozent notwendig. Selbst die Hälfte erscheint im Lichte vergangener Anstrengungen nahezu unerreichbar – und dies auch unter Einbeziehung der Möglichkeit der Industrieländer, sich via globalen Emissionshandel freizukaufen.
Die Ökonomie bietet für diese Fragen Widersprüchliches an: Einerseits ist die Vorstellung grenzenlosen (entmaterialisierten) Wachstums vereinbar mit theoretischen Modellen. Andererseits können empirische Studien, mit Ausnahme weniger Problemstoffe (z.B. Schwefeldioxid) bisher keine absolute Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch bestätigen. Trotz wertvoller Beiträge der Umweltökonomie ist die Mainstream-Ökonomie auf interdisziplinäre Forschungsansätze angewiesen.
Nachhaltige Änderung ...
Aus dem Blickwinkel der Ökologie beispielsweise erscheint unendlich exponentielles Wachstum in einer endlichen Welt abwegig. Und die moderne Glücksforschung sagt uns, dass materieller Wohlstand ab einem bestimmten Reichtumsniveau nur geringfügig zur Lebenszufriedenheit beiträgt.
Gewiss hilft technischer Fortschritt, die Grenzen des Wachstums zu verschieben. Wird aber die dank erhöhter Produktivität eingesparte Energie erst recht wieder einer erhöhten Produktion zugeführt, beißt sich die Katze in den Schwanz. Genau das beschreibt der so genannte Rebound-Effekt: Energieeffiziente Autos entlasten die Geldbörse, doch das ersparte Geld wird nun für mehr Kilometer verausgabt oder gar für eine Flugreise.
Dazu kommt: Während die Wirtschaften der Schwellenländer auch nach der Krise exponenziell wachsen werden, ist in vielen Industrieländern bereits seit längerer Zeit eine abschwächende Tendenz zu linearem Wachstum erkennbar. Und je langsamer der Wohlstandskuchen wächst, desto schwieriger seine Verteilung.
... des Verhaltens
Die global nötige Emissionsreduktion bei gleichzeitig individuellem Wohlergehen und sozialem Ausgleich wird daher ohne Verhaltensänderungen nicht erreichbar sein. Insbesondere Konsumenten des reichen Nordens sind gefordert, soll den armen Ländern nicht ihr Anteil am materiellen Wohlstand vorenthalten werden.
Nachhaltige Verhaltensänderungen können aber nicht von Haushalten und Unternehmen allein getragen werden. Sie setzen entsprechende politische Rahmenbedingungen voraus: Informationen, ökonomische Anreize (Steuern oder Zertifikate) und Gebote, begleitende Prozesse und die Vorbildwirkung von Behörden; alles in allem eine nachhaltige Steuer-, Struktur- und Konjunkturpolitik.
Die Berücksichtigung von Wachstumsgrenzen erfordert insgesamt eine Ökonomie, die sich an langfristig umweltverträglicher Optimierung der Lebensqualität orientiert. De facto wissen wir noch viel zu wenig darüber, wie eine Wirtschaft mit geringem oder gar ohne Wachstum Arbeitsplätze schafft, Armut beseitigt oder in Bildung und Pflege investiert und gleichzeitig die Klimaveränderung in erträglichen Bahnen hält. Höchste Zeit also für einen neuen wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt.
Energiekosten fressen 3/5 der Einnahmen durch Wirtschaftswachstum
Der Klimawandel durch steigenden CO2-Ausstoß und begrenzte Rohstoffe sind aber nur ein Teil der kommenden Probleme, die es zu lösen gilt. Denn Wirtschaftswachstum bedeutet in Zukunft keineswegs auch mehr Einnahmen. Die deutschen Warenausfuhren in die Bric-Länder sind zwischen 1998 und 2008 um 63 Mrd. Euro gestiegen. Im Gegenzug haben wir 2008 allerdings 49 Mrd. Euro mehr für Öl ausgeben müssen als 1998.
Die Konjunkturlokomotivenfunktion der Schwellenländer mit dem Wachstum in den aufstrebenden Volkswirtschaften ist hauptverantworlich für den Anstieg der weltweiten Rohstoffpreise. Den Daten von BP zufolge hat dieser dazu geführt, dass in Deutschland allein die Ölrechnung zwischen 1998 und 2008 um rund 49 Mrd. Euro gestiegen ist, obwohl der Ölverbrauch in dieser Zeit um 14 Prozent gefallen ist und die DM respektive der Euro um fast ein Drittel gegenüber dem Dollar zugelegt haben. Das entspricht fast drei Fünfteln der Einnahmen, die Deutschland 2008 durch die Warenausfuhr in die Bric-Länder erlöst hat! In ähnlicher Weise hat die Zunahme der Rohstoffpreise auch die meisten anderen Industrieländer getroffen, die 2008 immerhin noch für 79 Prozent des deutschen Warenexports standen (OECD-Länder).
Das dürfte zumindest zum Teil erklären, warum die realen Inlandsaufträge in der hiesigen Industrie oder die realen Umsätze im deutschen Einzelhandel auf dem Niveau von vor 20 Jahren herumhampeln. Und warum die Aktienmärkte der Industrieländer – in realen DM/Euro ausgedrückt – sich auf dem Stand vom Sommer 1989 bewegen, obwohl doch kein Tag vergeht, an dem wir nicht von irgendwelchen Ökonomen oder Strategen über die segensreichen Wirkungen des Schwellenländerwachstums auf die hiesige Wirtschaft oder auf die Unternehmensgewinne belehrt werden.
Nun gibt es ja aber zum Glück Lichtblicke im Auftragsbericht für das Jahr 2010.
Allerdings laufen wir Gefahr, dass wir ohne einschneidende Veränderungen in unserem Konsumverhalten in eine Wachstumszwickmühle kommen. Denn steigender Konsum wird in Zukunft die Preise nicht automatisch senken, da die Variable Rohstoffe und im Speziellen die Energiekosten eine immer entscheidendere Rolle spielen werden. Die Lösung kann folglich nur heissen: Qualität statt Quantität. Die Zeit, die Gesellschaft und Wirtschaft auf die Veränderungen vorzubereiten, wird knapp. Es bleibt zu hoffen, dass alle Beteiligten, wir Konsumenten selber, das Wirtschaftssytem und letztlich natürlich auch unser Ökosytem anpassungsfähig sind.
(*Der Volkswirt Niko Paech, 48, ist Privatdozent an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
Gunnar Böttger