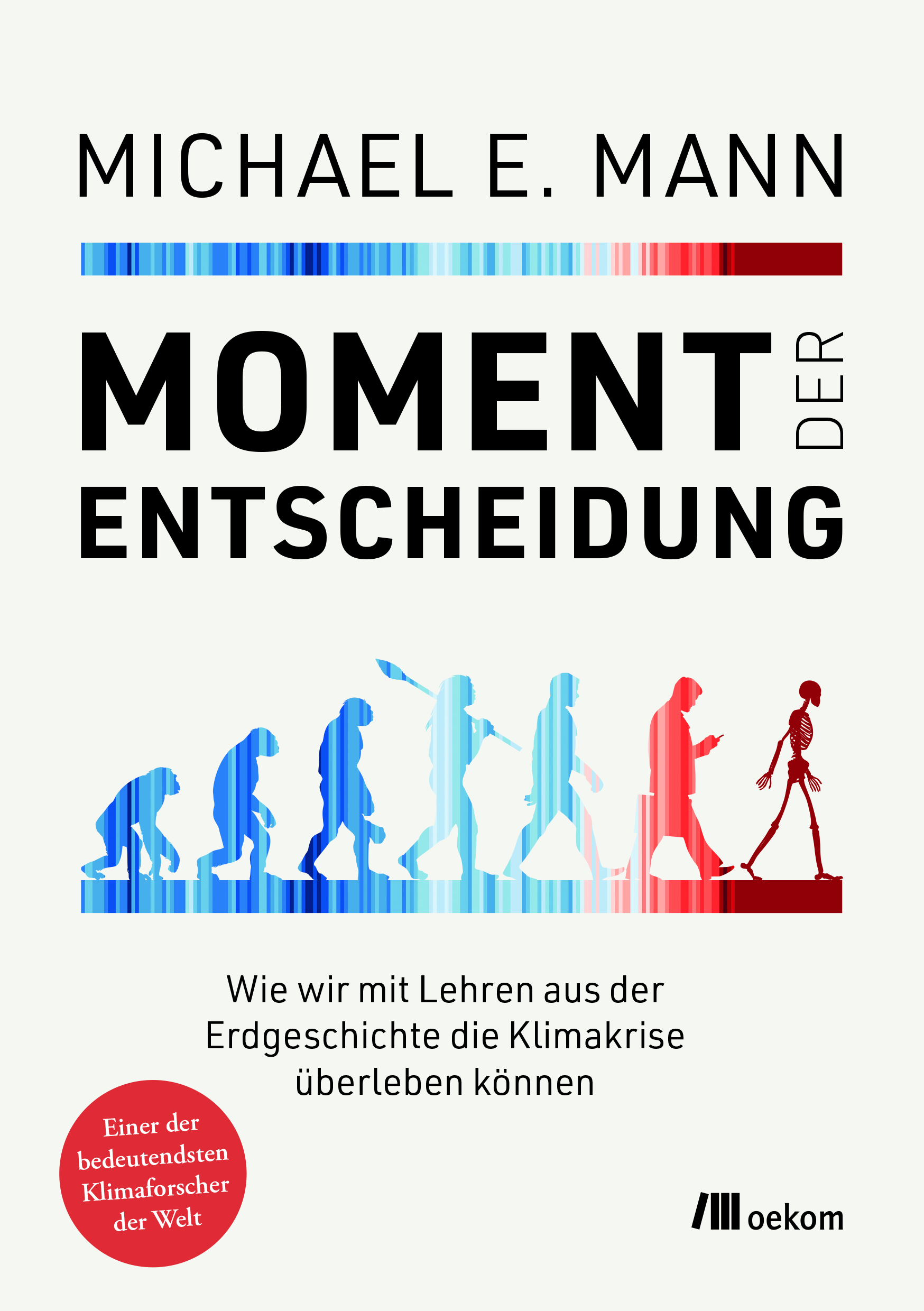Wer entscheidet über die Energiewende?
Strommarktdesign oder dezentrale Versorgung: Zur Lage der Energiewende im Jahr 2015: Die Debatte um die Zukunft der Energiewende konzentriert sich stärker denn je auf den Strombereich, aktuell auf das Thema eines neuen Strommarktdesigns. Betrachtet man den Diskussionsverlauf, wie er von Wirtschaftsminister Gabriel seit Beginn seiner Amtszeit entlang von EEG 2014, Grün- und Weißbuch hin zum Marktdesign-Gesetz (EnWG-Novelle September 2015) eingetütet worden ist, gewinnt man den Eindruck, es herrsche unter seiner Regie ein großer Konsens. Alle an der Energiewende Interessierten scheinen, trotz der weitgehenden Eliminierung der Photovoltaik im Jahr 2015, Hand in Hand für Gabriels‘ Strommarktdesign 2.0 zu arbeiten. Offene Kritik zieht nur das Ausschreibungsverfahren für Solarparks auf sich. Die Tatsache, dass der Solarpark in Deutschland praktisch tot ist, wird hingenommen, es gibt ja noch die Dächer. Die Frage, welche Strategie sich hinter dem PV-Kahlschlag und den Marketingbegriffen verbirgt und ob es demnächst auch dem Onshore-Wind an den Kragen geht, wird jedenfalls wenig vernehmbar gestellt.

Investitionsruine: Zwei neue Blöcke des Steinkohle-Kraftwerks Westfalen Hamm: für zwei Milliarden Euro erbaut – waren nie am Netz; das Geld mit dem die RWE baute, kam von Stadtwerken aus NRW. Foto: Oberzig

Erzeugervielfalt und mittelständisches Investment kann ein stabiles Element der Energieversorgung sein. Foto: Oberzig
Es scheint, dass Gabriels Politik mitsamt ihren Schlagwörtern eine Nebelwand bilden, hinter der für viele, die die Energiewende bis zu ihrem heutigen Stand mit vorangetrieben haben, ein unbekanntes Territorium liegt. Eines, von dem sie selbst gar nicht so klar sagen können, wohin die Reise führen soll. Ist Gabriels Kurs, der von Stromkonzernen, deren Think Tanks und den Mainstream-Medien vorangetrieben wird, richtig oder ruiniert er die Energiewende? Auch wenn sich manche Energiewendefreunde, EE-Hersteller und Projektierer der Illusion hingeben mögen, die alten fossilen Platzhirsche hätten sich vom Saulus zum Paulus gewandelt, ist Vorsicht angesagt. Misstrauisch macht, dass diejenigen, die früher prinzipiell gegen eine Energiewende waren, sich heute intensiv für ein Strommarktdesign 2.0 einsetzen. Gleichzeitig lässt sich aber beobachten, wie sie in anderen Energiebereichen – gemeint ist der stockende Zubau von EE-Wärmetechnik und der Stillstand bei der E-Mobilität – den Fuß nicht von der Bremse nehmen.
Selbstorganisation statt Zentralität
Bei den neuen Energiewendefreunden darf man nicht vergessen, dass ihr Kapital nach wie vor in fossilen Anlagen und vor allem in zentralisierter Technik steckt. Das prägt ihre Interessenlage und definiert ihr Handeln. Vor allem aber beschränkt sich dieses fossile Kapital nicht auf die vier großen Stromkonzerne. Diese sind nur die Spitze des Eisberges. Gewissermaßen unter Wasser finden sich die Öl- und Gaskonzerne, die Automobilindustrie und, nicht zu vergessen, die Finanzindustrie, die sich gerade im Fracking-Geschäft, mit ungewissem Ausgang, engagiert hat. Die mit ihnen verwobene Machtelite mag sich zwar verbal an die Spitze der Energiewendebewegung setzen, die Monopole wollen aber die Kontrolle über das Energiesystem nicht abgeben, und ihr angelegtes Kapital nicht aufgeben.
Seit der Einführung von Gas- und Stromnetzen waren diese weitgehend zentral gesteuert und in Privatbesitz. Das Stromnetz in Deutschland, fälschlicherweise seit 1935 als „öffentlich“ bezeichnet, war ein einfaches und überschaubares System. Auf der einen Seite gab es Millionen kleiner und großer Verbraucher, die sich keinen Kopf um die Funktionsweise und Stabilität des Netzes machen mussten. Auf der anderen Seite steuerten wenige EVUs mit großen, zentralen Leitwarten die Stromerzeugung und –verteilung. In diesem System gab es nur eine Richtung, in die der Strom floss: von den Großkraftwerken hin zu den Verbrauchern. Die Systemverantwortung lag bei den EVUs, die sich mit dem Energiewirtschaftsgesetz (Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13.12.1935) zu Monopolisten entwickelten. Daran änderte sich auch nichts, als im Zuge der sogenannten Liberalisierung 1998 die Trennung von Stromerzeugung und -verteilung eingeführt wurde. Auch durch das EEG wurde am Konstrukt der zentralen Regelung nichts verändert.
Die fossilen Monopole konzentrieren sich bei ihrer Offensive in Deutschland nicht zufällig auf ein neues Strommarktdesign. Hier haben ihnen die Erneuerbaren auch schon am meisten zugesetzt. Mit einzelnen, zu ihren Renditevorstellungen passenden EE-Technologien (Offshore Wind), neuen Strukturen (Stromautobahnen) und Energiedienstleistungen, soll die zentrale Struktur weitmöglich erhalten bzw. konsolidiert werden. Ein Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Strombörse, die für finanzkräftige Firmen ein ideales Betätigungsfeld ist. Kleine und mittlere Produzenten brauchen auf diesem Parkett die „Hilfe“ von Vermarktern, die am Ende des Tages meist doch wieder nur die altbekannten Namen tragen werden. Deutlich wird ihr Führungsanspruch in der Vorstellung, die Erneuerbaren müssten in den Strommarkt integriert werden. Also die alten Platzhirsche weisen den Newcomern einen monopolverträglichen Platz im alten System zu, welches sie zu ihren Konditionen umstrukturieren wollen. Das ist etwas anderes, als sich kompromisslos dem Erhalt des Klimas und der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten zu verschreiben.
Nun bieten die Erneuerbaren das Potenzial für kleinteilige und dezentrale Produktion im Strom- und Wärmebereich. Eine zentrale Steuerung und ein deutschland- oder gar europaweites Verbundnetz ist für sie nicht erforderlich. Gerade durch Power Electronics, durch elektrische und thermische Speichertechnologien sowie die Verknüpfung von Strom, Wärme und Mobilität entsteht mit der Dezentralität die effektivste Lösung. Eine zentrale Steuerung ist angesichts der Fortschritte der Digitalisierung nicht nur überflüssig, sie ist die unwirtschaftlichste Variante. Technisch bietet dies die Chance eines mittelständischen und bürgerorientierten Energiesystems. Politisch stehen dem die alten Strukturen rund um die Energiemonopole entgegen. Jüngstes Beispiel ist die geplante „Reform“ des KWK-Gesetzes, die gegenwärtig als Realsatire abläuft. Es soll so umgestrickt werden, dass Mieterstrom-Modelle der Wohnungswirtschaft, die ein Paradebeispiel für dezentrale Wärme- und Stromproduktion abgeben könnten, möglichst verhindert, zumindest aber in Grenzen gehalten werden können.
Betreibervielfalt und Demokratie
Sicher lässt sich sagen, dass die Energiemonopole ihre Strategie der strikten Ablehnung der Energiewende zugunsten eines flexiblen „Ja, aber…“ aufgegeben haben. Sie sind weit davon entfernt, eine fertige polit-strategische Lösung parat zu haben. Darauf deutet der Streit um die Kapazitätsmärkte wie der um die Kosten des Atomausstiegs hin. Diese Widersprüche im Lager der Fossilen liegen vor allem daran, dass die technologische Entwicklung immer wieder Innovationen hervorbringt, die die zentralistischen Träume der Monopole konterkarieren. Das alleine wird aber nicht ausreichen, um die Energiewende auf ein sicheres Gleis bis 2050 zu setzen. Denn ein Teil der Energiewendebewegung verharrt in einer Technikzentriertheit, die davon ausgeht, dass sie den technischen Fortschritt auf ihrer Seite hat, ja diesen gewissermaßen repräsentiert. Dieser Determinismus suggeriert, dass die Überlegenheit der EE-Technologien automatisch zum Durchbruch der Energiewende führen wird (wir schlagen sie mit F&E). Tatsächlich verstellt er den Blick auf die Lage und macht politisch handlungsunfähig.
Neben der Idee der Dezentralität muss ein weiteres Element treten, über dessen Bedeutung sich die Energiewendebewegung bewusst werden und das sie durchsetzen muss. Die Erneuerbaren finden als fluktuierende Energien ihre wirkliche Stärke erst in der Kombination bzw. im gegenseitigen Verbund. Gut ausgedrückt wird das in Begriffen wie Strom-Wärme-System, Kombikraftwerken oder auch Verbundkraftwerk. Damit dies nicht nur Begriffe bleiben, müssen diese Stärken der Erneuerbaren endlich Eingang in die Regelwerke finden. Die Förderung von Verbundsystemen und Netzwerken – jenseits der Monopolstrukturen – sollte z.B. in das bevorstehende EEG 3.0, zumindest als Ausnahmetatbestand, aufgenommen werden, um später in einem EEG 4.0 zur Regel werden zu können.
Auf Seiten der Protagonisten der Energiewende existiert seit der Durchsetzung des EEG weder ein konsensfähiges politisches Konzept noch eine technologische Vorstellung (Verbundkraftwerke, separate Netze), wie die Systemverantwortung von den Fossilen zu den Erneuerbaren hinüberwachsen könnte. Die bekannten Hochrechnungen, die eine 100-Prozent-Abdeckung mit EE bis 2050 verkündeten, reichen nicht aus. Die Frage nach der Systemverantwortung berührt direkt die Machtstrukturen im Stromsystem. Unter diesem Gesichtspunkt kommt auch der Gedanke zu kurz, dass die Erneuerbaren zum wichtigen Bestandteil der Zivilgesellschaft geworden sind, deren Existenz für die Demokratie von großer Bedeutung ist.
Klaus Oberzig