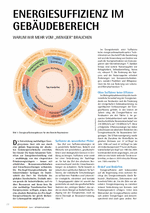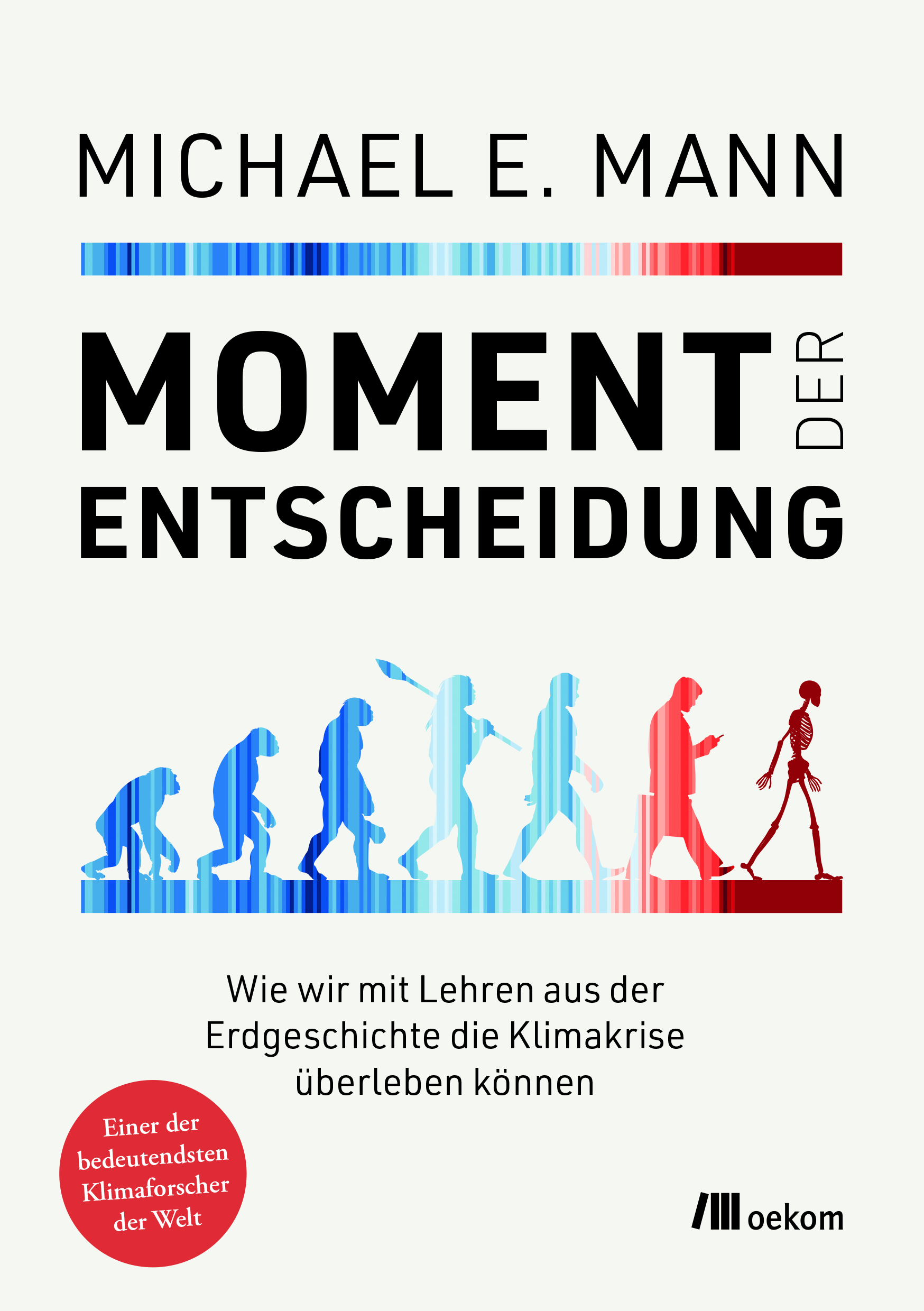Energiesuffizienz im Gebäudebereich
Warum wir mehr vom "Weniger" brauchen: Die Entwicklung nachhaltiger Energiesysteme lässt sich nur durch eine globale Begrenzung der absoluten Endenergieverbräuche erreichen. Der Grund: Die heute bekannten Techniken zur Energiebereitstellung sind - unabhängig von den eingesetzten Primärenergieträgern - immer mit erheblichen Ressourcenverbräuchen und Umweltauswirkungen verbunden. Die Pro-Kopf-Energieverbräuche der Industrieländer betragen im Durchschnitt das Drei- bis Vierfache des globalen Durchschnitts. Deshalb müssen gerade die Industrieländer, weil sie über Ressourcen und Know-how für eine nachhaltige Transformation ihrer Energiesysteme verfügen, zeigen, dass eine absolute Reduktion des Pro-Kopf-Energieverbrauchs bei gleich bleibender Lebensqualität möglich ist.
Suffizienz als wesentlicher PfeilerDas Ziel von Suffizienzstrategien ist es persönliche Bedürfnisse, Bedarfe und Wünsche mit persönlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Grenzen in Einklang zu bringen. Suffizienz setzt somit bei einer Veränderung der Nachfrage an. Sie hat das Ziel den absoluten Ressourcenaufwand und die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Dafür braucht es jedoch einen politischen Rahmen für Suffizienz, der individuelle Entscheidungen zu suffizienten Praktiken und Lebensstilen ermöglicht, erleichtert und bestärkt. Ausgangspunkt dabei ist sowohl das persönliche als auch das gesellschaftliche Ausloten des "richtigen Maßes", das weder zu einem Mangel an Bedürfnisbefriedigung wie der Energiearmut, noch zu einem Übermaß an Ressourcennutzung, führt.
Im Energiebereich setzt Suffizienz beim energieverbrauchsrelevanten Techniknutzen an. Das betrifft die Ausstattung mit und die Anwendung von Geräten wie auch die Inanspruchnahme von Konsumgütern oder Dienstleistungen. Darüber hinaus sind weitere Nutzenaspekte wie Behaglichkeit, Selbstdarstellung, Status etc. relevant. Die Änderung des Nutzens und der Nutzenaspekte erfordert Änderungen von Konsumentscheidungen, sozialen Praktiken und Alltagsroutinen bis hin zur Änderung von Lebens- und Wirtschaftsweisen.
Ohne Suffizienz keine Effizienz
Im Wohngebäudebereich hat die kontinuierliche Verschärfung der Energiestandards von Neubauten und die Förderung der energetischen Gebäudesanierung zu signifikanten Verbesserungen der Energieeffizienz geführt. In den letzten 20 Jahren stieg die Energieeffizienz von Neubauten um den Faktor 2. Im gesamten Gebäudebestand sank damit der durchschnittliche Raumwärmebedarf von 210 kWh/m2a auf 170 kWh/m2a. Diese erfolgreiche Effizienzstrategie hat bisher jedoch kaum zur absoluten Reduktion des Energieverbrauchs für Raumwärme beigetragen. Die Effizienzsteigerung wurde durch die Zunahme der Wohnfläche im gleichen Zeitraum von 37 m2/Kopf im Jahr 1996 auf rund 47 m2/Kopf im Jahr 2016 überkompensiert 6) So ist der Raumwärmebedarf pro Kopf von 1985 bis 2005 kontinuierlich leicht angestiegen, erst seit 2005 ist eine leicht sinkende Tendenz erkennbar, so dass er 2010 etwa das Niveau von 1985 erreichte .
Bedarf und Bedürfnis
Energiesuffizienz zielt insbesondere auf die Begrenzung eines weiteren Anstiegs des Energieverbrauchs durch Rebound-, Wachstums-, Einkommens- und Komforteffekte ab. Um die Ziele zur absoluten Energieeinsparung zu erreichen müssen Veränderung von Konsum- und Nutzungsmustern erfolgen. Unter dem Blickwinkel der Energiesuffizienz stellen sich andere Energiefragen und dementsprechend sind auch ganz andere Antworten, Lösungsideen und -muster als bei Effizienz- und Konsistenzstrategien notwendig 8):
- Welche Bedarfe und Wünsche wollen oder müssen wir mit Hilfe von technischen Energiedienstleistungen befriedigen?
- Wann und warum nutzen wir Technik, die mit Energieverbrauch verbunden ist?
- Ist der mit technischem Energieaufwand bereitgestellte Techniknutzen überhaupt zeitlich, räumlich, qualitativ und quantitativ adäquat, um die individuell und über die Zeit variierenden Bedarfe, Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen?
In einem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt "Energiesuffizienz" wurden drei prinzipielle Ansätze für Suffizienz identifiziert:
- Zeitliche und räumliche Anpassung der bereitgestellten an die tatsächlich in Anspruch genommenen Güter, Dienstleistungen und Funktionen als Ansatz zum Abbau von Fehl- und Überdimensionierung: Mögliche Ansätze liefert die Anpassung von Wohnungsgrößen an Bedarfe der demografischen Entwicklung, die Abschaltung nicht benötigter Geräte oder die Reduktion von Raumtemperaturen bei Abwesenheit. Randbedingung einer Anpassung ist, dass der tatsächlich benötigte bzw. gewünschte Nutzen qualitativ und quantitativ konstant bleibt, aber der angeforderte bzw. der gelieferte Techniknutzen möglichst passgenau zu den Nutzerbedürfnissen bereitgestellt wird. Die Anpassung zielt damit auf den Abbau oder die Vermeidung überdimensionierter, nicht angeforderter oder nicht in Anspruch genommener Lieferungen von Techniknutzen ab.
- Reduktion der Nachfrage nach energierelevanten Gütern, Dienstleistungen, Funktionen oder Infrastrukturen: Dieser Suffizienzansatz führt zu einer quantitativen Verringerung der Nachfrage. Ohne die Verfügbarkeit nachgefragten Güter und Dienstleistungen einzuschränken, sollten diese jedoch in geringerem Umfang konsumiert oder in Anspruch genommen werden. Konkret betrifft dies beispielsweise die Wohnfläche pro Kopf, das Raumtemperaturniveau oder die Länge der Arbeits- und Versorgungswege.
- Substitution der Nachfrage nach energie- und ressourcenintensiven Gütern und Dienstleistungen: Der Ersatz technischer Dienstleistungen durch nicht-technische Praktiken, andere Formen des Wohnens und Arbeitens und der funktionalen Definition von Räumen führt zu einer qualitativen Veränderung der Nachfrage.
Um eine Substitution vornehmen zu können, müssen in der Regel entsprechende gemeinschaftliche, öffentliche oder private Infrastrukturen und Dienstleistungsangebote verfügbar sein. Substitution muss stets hinsichtlich ihrer Verlagerungseffekte analysiert und bewertet werden, denn auch bei Substitutionsoptionen kann es zu Rebound- oder Backfire-Effekten kommen, wenn der Energieverbrauch des Substitutionspfades kaum geringer oder sogar höher als der des ursprünglichen Pfades ist. Letzteres würde der Definition von Energiesuffizienz nicht mehr entsprechen.
Energiesuffizient Bauen und Wohnen
Auf Basis der drei prinzipiellen Suffizienzansätze lassen sich folgende Frage- und Aufgabenstellungen einer Energiesuffizienz-Strategie im Bereich Bauen und Wohnen konkretisieren:
- Wie viel Energie, welche bereitgestellten energieverbrauchsrelevanten Güter, technischen Funktionen oder Dienstleistungen bzw. welchen Anteil des bereitgestellten Nutzens nutzen wir nach Anschaffung, Inbetriebnahme oder Anforderung tatsächlich?
- Welche Änderungen sozialer Praktiken beim Umgang mit energieverbrauchsrelevanten Gütern, Funktionen und Dienstleistungen sind nötig und möglich?
- Welche Eigenschaften müsste eine nutzungsadäquate Technik haben, die Nutzern einen sparsamen Umgang mit Energie überhaupt ermöglicht bzw. sie beim sparsamen Umgang mit Energie unterstützt?
- Wie müssen politische Rahmenbedingungen und Instrumente ausgestaltet werden, um diese Fragen aufzunehmen?
Daraus folgen die wichtigsten Handlungsfelder einer Suffizienzstrategie für den Gebäudebereich.
lesen Sie weiter in der SONNENENERGIE
... den kompletten Artikel lesen Sie in der SONNENENERGIE. Hier können Sie sich der DGS anschließen, Sie erhalten die SONNENENERGIE dann regelmäßig frei Haus geliefert, lukrative Prämien erleichtern zudem den Beitritt. Hier können Sie nachsehen wo sich der nächstgelegene Verkaufsstand für den Kauf des aktuellen Einzelheftes befindet.
Die SONNENENERGIE gibt es auch in einer digitalen Version. Die Online-Ausgabe ist sie mit allen gängigen Systemen kompatibel und plattformübergreifend nutzbar. Die digitale Version Deutschlands ältester Fachzeitschrift für Erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Energiewende können Sie überall komfortabel lesen: Ob mit dem Browser am PC und Mac, auf dem Laptop, auf Ihrem Smartphone, dem Tablet-PC oder auch mit dem iPad. So haben Sie die SONNENENERGIE immer bei sich, ob zu hause oder unterwegs. Näheres dazu hier.
Dr. Lars-Arvid Brischke