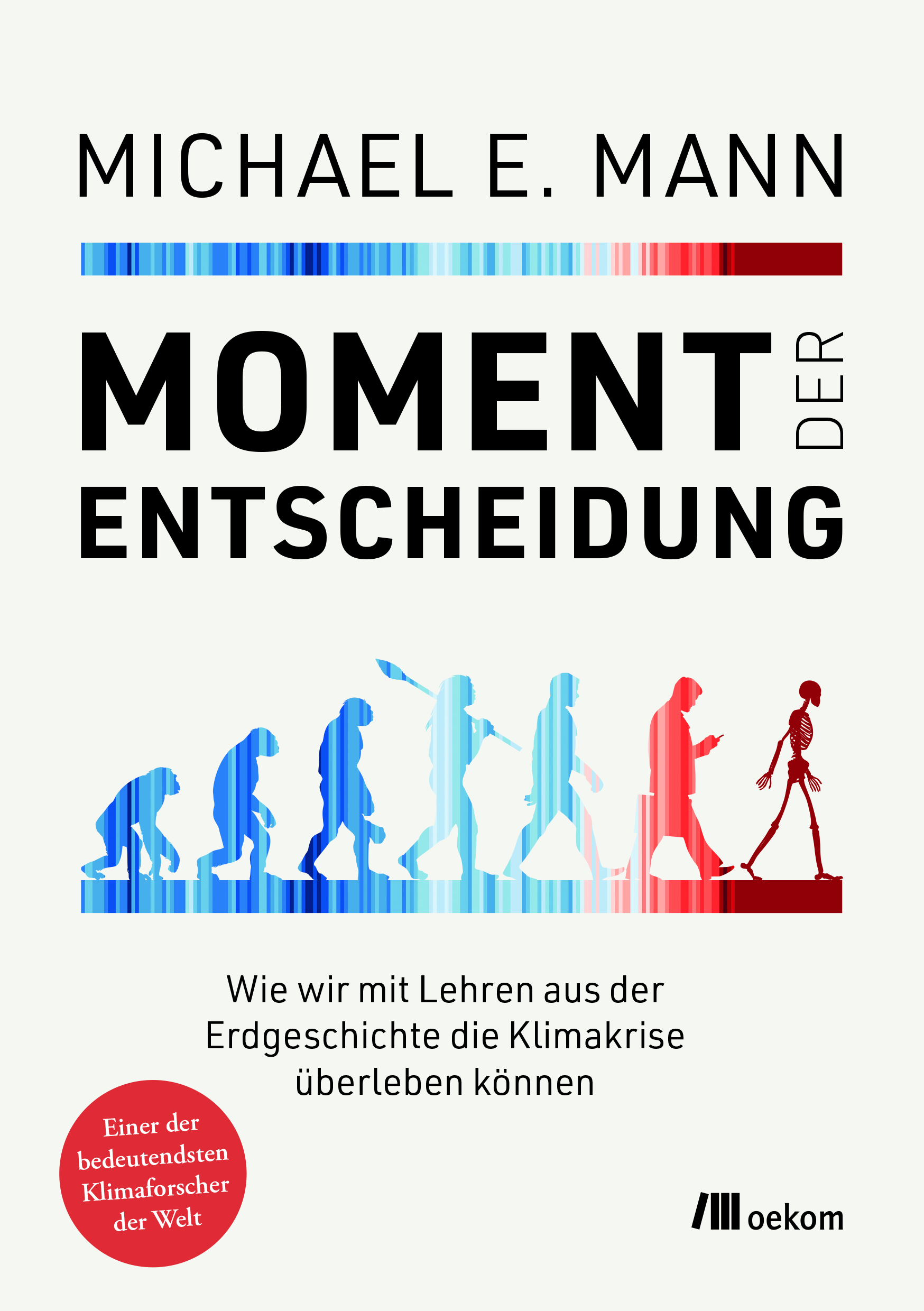Der E-Auto-Gipfel
Mit der Gründung der nationalen Plattform Elektromobilität möchte die Bundesregierung den nächsten Schritt hin zum Leitmarkt für Elektromobilität gehen. W ir erinnern uns. Im Jahr 1995 endete der größte deutsche Flottenversuch zur Elektromobilität auf der Insel Rügen. Leider gelang es den Automobilherstellern fast zeitgleich das Luftreinhaltungsgesetz („Clean air act“) in Kalifornien zu kippen, denn nur dort wurden Elektroautos gesetzlich eingefordert, nur für diesen Markt hätte man saubere Autos entwickeln müssen. Mit dem Ende des kalifornischen Elektroautomarktes wurde „Elektroauto“ in der Automobilbranche auch wieder zu dem Unwort, dass es schon immer war. Fahrzeuge, die kein Erdöl, keinen Verbrennungsmotor und vor allem fast keine Ersatzteile brauchen, gefährden die etablierten Marktverhältnisse und die eingefahrenen Geschäftsmodelle.

Die politische und wirtschaftliche Prominenz Deutschlands erklärt den handverlesenen Zuhörern und sich selbst die Elektromobilität. Das türkise „Rednerpult“ der Kanzlerin ist eine sprechende Ladesäule über deren Relevanz man vortrefflich streiten könnte, Foto: Thomic Ruschmeyer

Das deprimierende Wetter passte erstaunlich gut zu der Leistungsschau deutscher Elektromobilität. Es wurden fast ausschließlich Konzeptfahrzeuge gezeigt, die — zumindest in heute absehbarer Zeit — nicht in Serie gehen werden, Foto: Thomic Ruschmeyer
Keine Wunder
Dass im Jahr 2007 „Elektromobilität“ im Meseberger Klimaschutzpapier aufgetaucht ist, war eigentlich ein kleines Wunder, denn die Automobilbranche hatte auf gar keinen Fall darum gebeten. Doch Elektroautos waren schon immer eine Technik der Krisenzeiten und nun, da das Erdöl sich dramatisch verknappen wird, führt an der E-Mobilität wieder einmal kein Weg vorbei. Zu dieser Analyse ist man zumindest in China, Israel und den USA gekommen. Da ist es dann kein Wunder, dass unsere Bundeskanzlerin erkannt hat, dass wir da mitspielen müssen. Doch wie bewegt man nun eine träge Industrie dazu mitzumachen?
Auf der Nationalen Strategiekonferenz im November 2008 (siehe SONNENENERGIE 2009-01) wurden erstmal, diese beiden Losungen herausgegeben: „Deutschland wird Leitmarkt für Elektromobilität“ und „Eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020“.
Kein Ziel
Auf „Elektroautos“ wollte man sich damals nicht festlegen. Zur Not könnten auch Elektrofahrräder das Ziel erfüllen. Auch die Frage, in welchem Land diese Fahrzeuge hergestellt werden sollten, wollte man nicht so genau definieren. Als dann Anfang 2010 der neue Umweltminister Röttgen mutig die Formulierung „eine Million deutsche Elektroautos“ in den Raum gestellt hatte, dauerte es natürlich nicht lange, bis man ihn wieder zurückgepfiffen hatte. Auf „Autos“ konnte man sich in der Zwischenzeit als politisches Ziel zwar einigen, aber dass diese von deutschen Herstellern stammen würden, war dann offenbar doch zu gewagt.
Der Weg ist bekanntlich das Ziel und so hangelte sich die Regierung in drei Jahren von schwammigen Positionspapieren, über eine inszenierte Strategiekonferenz nun bis zu einem Über-Arbeitskreis: der Nationalen Plattform Elektromobilität. Auf einem von der Bundeskanzlerin einberufenen Elektromobilitätsgipfel am 3. Mai 2010 fiel dazu der Startschuss.
Kein Inhalt
„Wenn man nicht mehr weiter weiß, dann gründet man einen Arbeitskreis“. Die Nationale Plattform Elektromobilität hat davon sogar sieben:
- AG 1: Antriebstechnologie
- AG 2: Batterietechnologie
- AG 3: Infrastruktur
- AG 4: Standardisierung
- AG 5: Materialien und Recycling
- AG 6: Bildung
- AG 7: Rahmenbedingungen
In monatlichen Treffen sollen hier bis Mai 2011, dem Termin des nächsten Gipfeltreffens, klare Vorschläge für die Regierung erarbeitet werden. Im Umkehrschluss kann man also bereits sagen, dass deshalb ein weiteres Jahr auf politischer Ebene in diesem Lande nichts in Sachen Elektromobilität passieren wird. Denn die Regierung wird doch keine Fakten schaffen, solange die Expertenarbeitskreise noch diskutieren. Alles in allem sind das eher trübe Aussichten.
Auf die Gemeinsame Geschäftsstelle Elektromobilität der Bundesregierung (GGEMO) kam bereits kurz nach ihrer Gründung die hoch brisante Aufgabe zu, die je 20 Mitglieder der einzelnen Arbeitsgruppen auszuwählen. Die großen Branchenverbände der Energiewirtschaft (BDEW), Automobilindustrie (VDA) und der Großindustrie (BDI) kämpften um die politische „Macht“ auf diesem neuen Spielfeld. Auch wenn man sich von den Arbeitsgruppen keine wirklich neuen Erkenntnisse verspricht, denn im Grunde sind die Probleme und möglichen Lösungen bekannt, so gibt die Zusammensetzung der AG-Mitglieder immerhin einen guten Einblick in die politische Macht der einzelnen Akteure.
Viele Personalfragen
Die meisten Unternehmen, Verbände oder Forschungseinrichtungen, die sich einen Platz in einer der Arbeitsgruppen sichern konnten, sind auch bereits in einer der Modellregionen oder einem der Forschungsprojekte für Elektromobilität aktiv (siehe SONNENENERGIE 2009-04).
Interessant sind aber vor allem die, denen mehr als eine Stimme in der Nationalen Plattform zugesprochen wurde. In je sechs Arbeitskreise haben es, direkt oder durch ihre Tochterunternehmen, sowohl Daimler als auch Evonik geschafft. Als „Joint-Venture“ haben die beiden Partner damit in Summe rund 10% der Stimmen. Der Fraunhofer-Forschungsverbund ist immerhin mit fünf Instituten in drei Arbeitsgruppen vertreten. Auf lediglich vier Stimmen bringen es Opel und Siemens. Der Volkswagen-Konzern, BMW und die RWE kommen immerhin noch auf je drei Stimmen. Bosch, Ford und die Telekom sind nur in zwei Arbeitskreisen.
Die Erneuerbaren Energien sind in der AG-Infrastruktur einmal über die Firma Juwi vertreten, die auch zwei geförderte Forschungsprojekte zur Elektromobilität durchführt, und zum anderen hat auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) in der AG 3 eine Stimme. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie ist Mitglied im BEE und wird auf diesem Wege die Entwicklungen auf der Nationalen Plattform Elektromobilität verfolgen und, soweit möglich, mit gestalten.
Echte Überraschungen
Dass der ADAC aus Protest seine Teilnahme am Gipfeltreffen der Kanzlerin abgesagt hatte, war eine der wenigen Überraschungen. Offiziell wollte man dagegen protestieren, dass die Interessen der Verbraucher nicht ausreichend vertreten seien. Vermutlich bedeutet dies, dass man beim ADAC verärgert war, keinen leitenden Posten in den Arbeitskreisen bekommen zu haben. Auch der ADAC hat lediglich eine einzige Stimme in der AG 7.
Vielleicht hatte der ADAC, so wie andere Verbände auch, sogar darauf gepokert, den Posten des obersten Plattformkoordinators zu bekommen. Doch dieser ging, und das war die zweite Überraschung des Gipfels, an Henning Kagermann, den früheren Manager des Software-Konzerns SAP. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, der hat zumindest strategische Kompetenz bewiesen. Herr Kagermann ist unabhängig. Er hat keine aktive Vorstandsrolle bei SAP mehr und kommt weder aus der Automobilindustrie, noch aus der Energiewirtschaft. Doch da SAP die Geschäftssoftware der meisten Großkonzerne entwickelt hat, ist Herr Kagermann sicherlich mit beiden Branchen bestens vertraut und gut vernetzt. Für die Rolle des Vermittlers und unparteiischen Vorsitzenden bietet er somit tatsächlich die besten Voraussetzungen. Dass Kagermann, als Kenner der schnelllebigen EDV-Welt, den für Elektromobilität notwendigen Unternehmergeist der traditionell eher trägen Automobil- und Energiewirtschaft einhauchen wird, wäre dann aber doch eine sehr hoch gesteckte Erwartung.
Trübe Aussichten
Passend zu den trüben Erfolgsaussichten der Gipfel-Veranstaltung war auch das Wetter: kalter Nieselregen. Da half dann auch die Kulisse vor dem Brandenburger Tor nicht viel. Der Besucherandrang für die Begleitausstellung zur E-Mobilität im Außenbereich hielt sich sehr in Grenzen. Für die Kenner der Szene bot die Ausstellung auch keine Überraschungen. Zu sehen waren einige Studien und Konzeptfahrzeuge (VW E-Taxi, das EWE E-Mobil, Audi e-tron Sportwagen) und die Autos der Modellregionen (BMW Mini-E, Smart ED, Volkswagen E-Golf, Daimler Elektro-Vito, MAN Hybridbus, der Fräger Stromos und das Kommunalfahrzeug Multicar mit E-Antrieb). Als echtes Vorserienmodell konnte man nur den Opel Ampera bezeichnen, doch auch dieser wird wohl nicht vor 2012 in Deutschland in den Verkauf kommen. Dazu gesellte sich ein von der Deutschen Bahn in England umgebauter Citroen samt DB-Carsharing Ladestation und den passenden Elektrofahrrädern und einigen exklusiven Scootern und E-Bikes, die man kurzfristig noch für die Ausstellung zugelassen hatte. Denn nichts sollte den Glanz der deutschen, elektromobilen Luxus-Konzeptstudien stören, schon gleich gar nicht käufliche Elektroautos aus dem Segment der elektrischen Leichtmobile. Es ging mal wieder mehr um den schönen Schein als um echte Substanz.
Kein Geld
Nachdem die Bundesregierung erst Anfang 2009 über das Konjunkturpaket rund 500 Millionen Euro in die angewandte Forschung im Bereich Elektromobilität gedrückt hat, sind die meisten Teilnehmer mit der Erwartung angereist, dass auf dem Gipfel eine „Verstetigung der Mittel“ verkündet werden könnte und dass es dann auf der exklusiven Plattform um die Aufteilung des Kuchens ginge.
Doch nicht nur die katastrophale Haushaltslage und die Finanz- und Euro-Krise haben dieser Erwartung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die Tatsache, dass bis auf weiteres nur ausländische Hersteller serientaugliche E-Autos liefern können, hat die direkte Förderung vorerst auf Eis gelegt. Denn schließlich geht es hier nicht um Klimaschutz, sondern um knallharte Politik für die Großindustrie, egal was im Meseberger Klimaschutzpapier auch stehen mag.
Elektromobilität braucht den klaren politischen Willen und nicht den x-ten Arbeitskreis. In Rügen war schon 1995 klar, was zu tun ist. Doch nun warten wir wieder bis Mai 2011 und es passiert erstmal wieder nix.
Tomi Engel